
Was den Hexen aber letztlich immer zum Verhängnis wurde, war ihr Kontakt mit dem Leibhaftigen. Nicht alles war schlecht im Mittelalter (trotz der Kathedralen)!
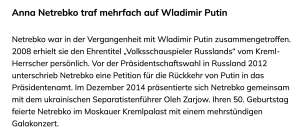
Die hexenszenetypische Schutzbehauptung, es habe sich bei dem besagten Kontakt um die unbewusste Verbindung mit einem Incubus gehandelt, entfällt also, und von der perfiden Masche, Satan im Nachhinein halbherzig abzuschwören, lässt sich eine wachsame kritische Öffentlichkeit nicht täuschen.
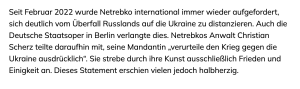
Um nicht länger als Russenhexe zu gelten, muss die sogenannte Diva bzw. „Mördersängerin” (so stand es auf einem Plakat) künftig und bis zum ukrainischen Endsieg vor jedem ihrer Auftritte öffentlich auf ein Putin-Porträt defäkieren und sich danach mit der russischen Fahne den Hintern abwischen; darunter wird man ihr keinen Sinneswandel abkaufen; man wird ihr überhaupt den Sinneswandel nie abkaufen, aber die ostentative Unterwerfung würde, vielleicht auch als Vorgeschmack auf künftige, gerade so genügen.
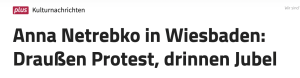
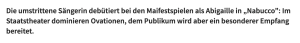
Über die Veranstaltung am Freitagabend wurde ich nur aus zweiter Hand, aber sehr gut unterrichtet. Es standen um die 200 Demonstranten – die Polizei sprach von 400 und verhielt sich auch sonst sehr instruiert – auf dem Platz vor dem Theater, manche phantasievoll auf Kriegsopfer geschminkt, und sie rückten von dort immer weiter gegen das Haus vor. Dessen Portal ist eine Kolonnade vorgelagert, die schließlich von den Protestlern besetzt wurde. Sodann versuchten mehrere von ihnen, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei unternahm – nichts. Nur die Security verhinderte, dass die Störung im Haus fortgesetzt wurde. Das Publikum musste sich an den Tumultanten vorbeidrängeln und deren Schmähungen anhören, weil es schließlich an einem Hexensabbat teilzunehmen gedachte; besagte Invektiven schlossen selbstredend die derzeit und wohl auch fürderhin beliebteste aller Beschimpfungen ein, nämlich, na was schon, den Ruf: „Nazis!”. Konzertgänger, weil sie die Netrebko hören wollen, als Nazis zu beschimpfen: Charmanter und intelligenter kann man für die Sache der Ukraine kaum werben.
Drinnen im Saal gab es ans Ausrasten grenzende Ovationen; ich erlebte am Sonntag einen begeisterten, aber wohl nur matten Abglanz davon.

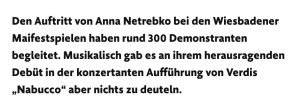
Da der politische Straßenlärm heute in den Theatern und Opernhäusern so allpräsent ist wie in der Literatur, den Künsten und den Gazetten sowieso, muss man wohl einen Teil des Jubels als Protest gegen die Geßlerhutaufsteller vor dem Haus und in den Medien werten, wobei das à la mode designte Modell des besagten Huts gelb ist und ein blaues Band hat. Bemerkenswert war freilich, dass der Wiesbadener Intendant nicht einknickte, obwohl ihm Lokalpolitiker nahegelegt hatten, er solle der Netrebko absagen, sie also praktisch zum Teufel jagen, nachdem sich ukrainische Stellen, wohl das Konsulat, beschwert hatten. Doch der brave Mann mag sich gedacht haben, dass er, der Intendant, und nicht irgendwelche Lokalpolitiker und Auslandsukrainer festlegen, wer auf der ihm anvertrauten Bühne singt, zumal er ja einen Vertrag mit der russischen Starsopranistin unterschrieben hatte und das Haus 24 Stunden nach der Ankündigung ihres Auftritts zweimal komplett ausverkauft war. Angeblich soll er auch dreist gefragt haben, was in irgendeinem strafrechtlich relevanten Sinn gegen die Dame vorliege und eine Kündigung des Vertrages rechtfertige.
Die Diva sang übrigens in der Verdi-Oper die Partie der Abigaille, der machtgierigen angeblichen Tochter des Nabucco (= Nebukadnezar II.), deren Staatsstreich scheitert, woraufhin sie sich vergiftet und in der Finalszene – wir sind in der Oper, dort bekommen sterbende Hauptfiguren immer einiges zu singen – um Vergebung fleht. Als Abigaille alias Netrebko letztmals naht, singt der Chor „La misera a che si tragge or qui?” (Was schleppt sich die Elende hierher?), was mich erheiterte. Zumal es weitergeht mit ihren Worten: „Io fui colpevole/Punita or ben ne sono! (Ich war schuldig, nun bin ich bestraft!) … Or chi mi toglie al ferreo/Pondo del mio delitto! (Wer nimmt mir jetzt das Eisen ab, die Last meines Verbrechens) … Te chiamo te Dio te venero! Non maledire, non maledire a me.” (Ich rufe dich Gott, ich bete dich an! Verfluche nicht, verfluche mich nicht.) Die Frevlerin bittet um Erbarmen, welch subtiler Zufall oder Zusammenfall! Dem FAZler ist er auch aufgefallen.
Ich habe früher nie auf dieses Libretto geachtet, das mit dem alten Babylon so viel zu tun hat wie Verdis fröhliche Piazza-Musik, wie ja überhaupt die Textbücher der italienischen Oper oft bedenklich in Richtung der deprimierend dämlichen TV-Shows dieses zugleich so weltklug-uralten und kindischen Volkes changieren. Doch mein Ehegespons, das zahlreiche Opern einstudiert und viele Sänger begleitet hat, meint, es sei ein typisch deutscher Spleen, sich besonders um die Textbücher zu kümmern, das komme von Wagner und Strauss, sei aber völlig unnötig; sie achte nie auf den Text, sondern interessiere sich stets nur für die Musik, für die Stimmen der Sänger, ob sie geschmackvoll phrasieren, ihre Einsätze hinbekommen etc.; schließlich heiße die Sache im Italienischen bel canto, nicht bel testo.
Die Ukrainer merzen gerade die russische Sprache und die russische Kultur bei sich im Lande aus. Das ist zwar weltgeschichtlich nichts Neues, aber in einem Volk, dessen Kultur mit jener des russischen quasi amalgamiert ist, eine besondere Brutalität. Ich wüsste übrigens nicht, dass in der Sowjetunion nach dem deutschen Angriff 1941 kein Beethoven oder Bach mehr gespielt, kein Goethe und kein Heine mehr gelesen worden wären, und mir ist ebenfalls nicht bekannt, dass die Nazis Tolstoi, Puschkin oder Tschaikowski verboten hätten. Ich vermag mich der Folgerung nicht zu verschließen, dass ein angegriffenes Volk das natürliche Recht besitzt, sich zu verteidigen, doch dieses korrupte Kiewer Regime wird mir mit jedem Tag suspekter, und ich finde es rotzfrech, wie Ukrainevertreter auf den moralischen Hühneraugen deutscher Offizieller herumtrampeln und nicht nur ständig neue Forderungen stellen – Waffen, Wiederaufbauhilfen, Flüchtlingsversorgung –, sondern den Deutschen obendrein vorschreiben wollen, was sie abgeben sollen, worauf sie verzichten können, woher sie ihre Energie beziehen und am Ende noch, wer bei ihnen auftreten darf.
***
PS: „Nach meinen Recherchen”, notiert Freund ***, „wurde übrigens russische Musik, auch Tschaikovsky, nach dem Kriegsbeginn 1941 in Deutschland nicht oder kaum mehr gespielt. Keine Ahnung, ob es ein wirkliches Verbot oder eine entsprechende Anweisung gab oder ob die ‚Kulturschaffenden’ selbst ‚im Herzen spürten’, was die Stunde geschlagen hatte. Man (oder besser mancher) war und ist hierzulande eben mit feinster Witterung quasi hochbegabt.
Toscanini dirigierte in New York während der gesamten Dauer des Krieges deutsche Musik, darunter umfangreichste Konzerte mit Wagner. Die BBC bestritt etwa 60 Prozent ihrer Klassiksendungen mit deutscher Musik und waren ganz offensichtlich nicht der Meinung, es befördere die Kriegsziele, wenn man der eigenen Bevölkerung die Matthäuspassion, Beethoven-Sinfonien, die Zauberflöte etc. etc. vorenthielte. Sogar die Sowjets spielten jede Menge Mozart und Beethoven. Lediglich die Deutschen…, ach lassen wir das!”
PS zum PS: „Die Reichsmusikkammer gab am 12 Juli 1941 bekannt, dass ‚die Werke russischer Komponisten bis auf weiteres ausnahmslos nicht aufgeführt werden. Sinngemäß ist auch die öffentliche Darbietung russischer Volkslieder unstatthaft’. Auch die von mir zuvor gelobte BBC hatte offenbar noch lebende bzw. vor nicht allzu langer Zeit verstorbene deutsche Komponisten auf einer ‚enemy music list’, darunter auch etliche ausgewiesene Regimegegner, Exilanten und Juden (!). Man wollte den deutschen und österreichischen Musikverlagen keine Tantiemen zukommen lassen. Die 60 Prozent deutscher Musik im Programm sind also offenbar vorwiegend mit den tantiemenfreien Bach, Mozart, Beethoven, Brahms etc. erzielt worden.”
***
PPS: Auch diese Maschinenpistolen könnten längst in der Ukraine sein!



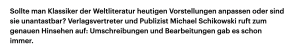
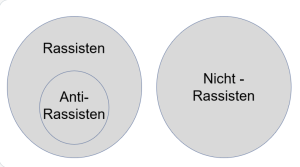
(H. Ling Roth, op. cit., pp. 63).
* Übersetzung: „Als Moffat und Smith die Stadt 1840 besuchten, wurde uns gesagt, dass ’sie auf einem offenen Platz in der Nähe des Marktplatzes schockiert waren von dem Anblick dessen, was man ein Golgatha nennen könnte, einen Ort, an dem menschliche Schädel aufgehäuft waren und in der Sonne bleichten. Noch mehr waren sie angewidert, als sie am Rande der Stadt, nicht weit von der Residenz des Königs, die Leichen von Männern sahen, die gerade erst geköpft worden waren und nun von Truthahnbussarden (eine Geierart – M.K.) gefressen wurden, und auf dem Dach einer nahe gelegenen Hütte zwei Leichen in sitzender Haltung. Der Gestank aus einer offenen Grube in der Nähe dieses widerlichen Ortes war fast unerträglich und ging, wie sie glaubten, von menschlichen Körpern im Zustand der Verwesung aus’…
Etwa zwanzig Jahre später wurden diese Schrecken von Burton vollständig bestätigt. An einem Tag schreibt er: ‚Als wir weitergingen, schrumpfte die Allee zu einer schmalen Gasse zusammen, und in ihrem tiefen Schatten sahen wir grüne und schimmelige Schädel herumliegen wie Kieselsteine. Von dort gelangten wir auf eine weite offene Fläche, die wir später Todesfeld nannten. Es war in der Tat ein Golgatha, ein Aceldama (Blutacker; Friedhof in Jerusalem – M.K.). Zwischen den trägen Truthahnbussarden, die sich in der Sonne wärmten, und dem Vieh, das auf dem blutgetränkten Boden weidete, begegnete manches gespenstisch weiße Objekt unserem Anblick, abscheuliche Überreste verwilderter Menschlichkeit, Opfer von Bräuchen und ähnlichen Feierlichkeiten. Unsere erste Idee war, dass wir auf dieser Straße in die Stadt geführt wurden, um einen Eindruck auf uns zu machen. Später stellte sich heraus, dass alle Straßen, die zum Palast führen, ähnlich eingerichtet sind.’
Und bei einer anderen Gelegenheit schreibt er: ‚Im Gras, rechts vom Weg, erschien die Gestalt eines bis zur Taille nackten Mannes, mit ausgestreckten Armen, die Handgelenke an einem Gerüst aus geschälten Stöcken befestigt, die hinter ihm in den Boden eingerammt waren. Einen Moment lang dachten wir, der arme Teufel wäre am Leben, aber nach ein paar Schritten überzeugten wir uns von unserem Irrtum. Er war nach afrikanischer Art gekreuzigt worden… Ein Seil als ‚Krawatte’, fest um den Hals an einen Pfahl gebunden, war die unmittelbare Todesursache; die Gesichtszüge drückten immer noch Erstickung aus, und die Tat war so frisch, dass, obwohl die Fliegen bereits da waren, die Truthahnbussarde ihre Aufmerksamkeit noch nicht darauf gerichtet hatten. Die Schwärze der Haut und das allgemeine Erscheinungsbild bewiesen, dass der Leidende ein Sklave gewesen war. Die vielen Männer und Frauen, die vorübergingen, zeigten keinerlei Regung, außer dass sie sich die Nase zuhielten, und es gab auch kein Anzeichen von Verwunderung, als ich zurückkam, um die schreckliche Szene zu zeichnen …
In der Nähe des Königspalastes hatte sich ein weiterer Tod ereignet; wir gingen dorthin und fanden eine Leiche, die splitternackt auf dem Rücken lag. Ein paar Leute standen daneben und betrachteten mit äußerster Unbekümmertheit ein entsetzliches Schauspiel. Die Beine des Elenden waren mit entsetzlicher Gewalt in der Mitte des Schienbeins gebrochen worden, eine tiefe Wunde befand sich unter dem linken Kiefer, und in der heißen, klaren Morgenluft waren die Züge bereits geschwollen und formlos geworden. Es war eine grundlose Barbarei … Die Gefangennahme von Opfern bei Nacht wirft ein grelles Licht auf den Terror, der ununterbrochen über den Köpfen der Bini geschwebt haben muss, denn einst nahm sogar ihr König an diesen nächtlichen Massakern teil…”
** Übersetzung: „Als wir uns Benin City näherten, kamen wir an mehreren Menschenopfern vorbei, lebenden Sklavinnen, geknebelt und auf dem Rücken liegend am Boden befestigt, die Bauchdecke in Kreuzform aufgeschnitten, der unverletzte Darm hing heraus. Diese armen Frauen durften so in der Sonne sterben.”
Der brutale Einbruch des Kolonialismus in die schwarze Hochkultur beendete auch diese jahrhundertealten Gebräuche.
Das Wetter.