Ein Buch fand seinen Weg zu mir (es hatte ihn wohl auch gesucht). Aufgetan, übersetzt und mit einem Nachwort versehen hat es ein Freund, weshalb bei der Besprechung noch strengere Maßstäbe walten müssen, als ohnehin schon an dieser härtesten Tür Münchens gelten, denn sonst geriete der Eckladenbetreiber in den Ruch von Vettern‑, ja Günstlingswirtschaft, mancherorts womöglich sogar in jenen versuchter Weltverschwörungsteilhabeerschleichung.
Ein Buch also, ein Roman, genauer: ein Kolportageroman bzw. eine Romansatire, mit unspektakulärem Titel, aber einem bekannten Autorennamen.
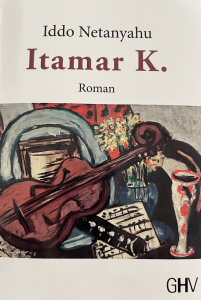
Iddo Netanyahu, Jahrgang 1952, ist der jüngere Bruder des israelischen Ministerpräsidenten. Der gelernte Radiologe – er studierte in den USA (Cornell University) – nahm am Jom-Kippur-Krieg teil und diente, wie seine beiden Brüder, in der Eliteeinheit Sayeret Matkal (der Älteste starb bei der Geiselbefreiung in Entebbe anno 1976). Seit fünfzehn Jahren lebt Netanyahu als Autor und schreibt vor allem fürs Theater. „Itamar K.” ist sein bislang einziger Roman und sein erstes ins Deutsche übersetztes Werk, was damit zu tun hat, dass deutsche Verlage und Gazetten dem Publikum fast nur linke, israelkritische Israelis präsentieren. „Itamar K.” aber ist eine Satire über die Linken: grotesk, bitter, deprimierend und zugleich rasend komisch.
Die Handlung spielt in der israelischen Kulturszene der 1990er Jahre. Bei der Lektüre war ich zunächst, wie man sagt, bass erstaunt, denn wenn man die Namen der Personen und Orte austauschte, könnte der Roman in Deutschland spielen, und zwar im heutigen, im besten Deutschland aller Zeiten – obwohl er bereits 1998 erschienen ist. Die inzwischen hochmodische kulturelle Selbstablehnung der akademischen Eliten, die tägliche Denunziation der westlichen Zivilisation als unterdrückerisch, rassistisch und kolonialistisch, die Verklärung der Dritten Welt, die Idealisierung ihrer Bewohner als arme, herzensgute Geschöpfe und Opfer des Westens, natürlich auch das Sexismus- und Diversity-Gedöns, der absurde Konstruktivismus an den Universitäten, dieses gesamte woke Larifari gehörte in Israel offenbar bereits vor mehr als einem Vierteljahrhundert zum Alltag (sie sind halt strebsam, die Juden). Die Rolle, die bei uns die Sachsen spielen müssen, übernahmen bzw. übernehmen dortzulande übrigens die Siedler.
Der titelgebende Itamar – wir können beim Vornamen bleiben, die Israelis sind ein informelles Volk – ist ein Violinist, der nach einem Unfall seine Profession nur noch als Hobby betreiben kann. Er kehrt aus den USA, wo er Film studiert hat, nach Israel zurück, mit einem Drehbuch im Gepäck, das von einem berühmten jüdischen Sänger handelt, einem (fiktiven) Weltstar des Kunstliedgesangs, der vor ein paar Jahren verstorben ist und mit dem er befreundet war. Für die Verfilmung gewinnt Itamar einen prominenten Fürsprecher, Türen öffnen sich, ein Produzent wird gefunden, Fördergeld ist vorhanden, die Sache könnte Gestalt annehmen. Doch Drehbuch und Autor geraten in den – ein Qualitätsjournalist würde schreiben: unerbittlichen – Schredder des Kulturbetriebs. Diese Apparatur, die von nationalem Selbsthass und politischer Korrektheit angetrieben wird, häckselt Karrieren, Freundschaften, Lehraufträge, Reputationen und lässt „Verleumdungsgeschnetzeltes” (S. 285) zurück. Ihr Bedienpersonal gehört zur linken Kulturschickeria – man könnte auch sagen: Es ist die linke Kulturschickeria – und setzt sich zusammen aus trendkonformen Autoren mit elastischen Ansichten, die so tun, als seien sie Freigeister, sogenannten Kreativen, die sich für Künstler halten und direkt oder indirekt von staatlichen Stiftungen alimentiert werden, was sie mit Linientreue danken, beflissenen Absolventinnen sogenannter geisteswissenschaftlicher Studiengänge, bereit zur Fabrikation von jeder Art Sozio-Bullshit, und natürlich aus jenen Journalisten, die progressiv gesinnt sind (also praktisch allen), die schreiben, was alle anderen auch schreiben, und behaupten, sie kämpften gegen den Konformismus und dafür, dass alle Menschen endlich Schwestern werden.
Da ist zum Beispiel der Schriftsteller, der im Gespräch damit prahlt, dass sein Buch in New York gleich in zwei Buchhandlungen ausliege, und sich sodann rühmt, er habe keine Angst davor gehabt, im Interview mit einem israelischen Sender den „Landraub” anzuprangern, der schon mit den ersten Tagen des Zionismus begonnen habe: „Ich war couragiert genug, gegen unsere ganze heuchlerische Geschichtsschreibung Haltung zu zeigen, denn dem echten Künstler ist Zivilcourage immanent.” In Israel die Armee oder die Siedler zu kritisieren, war damals beinahe so en vogue wie zur selben Zeit in der Bundesrepublik die Verächtlichmachung der Wehrmacht oder der Vertriebenenverbände (nein, das ist kein „Vergleich” der Wehrmacht mit der IDF, sondern ein Vergleich gewisser wohlfeiler Affekte); heute, eine zweite Intifada, zahllose Anschläge und Raketenbeschüsse später, schaut es ein bisschen anders aus.
Da ist die Fotografin, die Bildbände über Ohrläppchen, Nasenlöcher, kleine Zehen und Zungen veröffentlicht hat und nun davon träumt, eine Vernissage mit Fotos von Händen zu veranstalten, im Gegensatz zu ihren anderen „Arbeiten” sollen es aber nur die Hände einer einzigen Person sein, „die Hände eines Kämpfers”, die zuerst die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg berühren und sich dann „zum Friedensschluss ausstrecken”, die Hände Abu Ammars – sie nennt ihn bei seinem Kampfnamen –, „er und kein anderer”, the one and only: Jassir Arafat. Anfangs habe sie sich auf seine Lippen konzentrieren wollen, sagt sie, „aber das war mir nicht symbolisch genug”.
Da sind zwei hübsche Tel Aviver Kulturbetriebsmäuse, die einen jener Studiengänge absolviert haben, in denen aus Zitaten und Plastikbegriffen Theoriemüllhalden geschichtet werden. Beide forschen zum Thema „Die Frau als Sexobjekt im israelischen Film” („Die Stute im Monumental-Sandalenfilm” wäre auch nicht übel), eine schreibt parallel dazu ihre Diplomarbeit über „Die Zigarette im israelischen Film 1948–1958”. Ihre Gespäche, denen der Leser enthusiasmiert lauschen darf, klingen beispielsweise so: „Die Szene ist fellinesk oder vielleicht eher: fellinesk-pasoliniesk. Aber ich glaube, dass der Konflikt hier eher zusammenhängt mit der dynamischen Semantik des weiblichen Haars in der Weltliteratur.”
Mit einer der beiden beginnt Itamar eine Liaison, und parallel zu den erotischen Vergnügungen, die seine Geliebte spendet, genießt er die intellektuellen Freuden, die sie ihm in den Pausen gewährt: „Zehn Verse hat das Gedicht bloß. Aber was für Verse! Das lyrische Ich steht vor dem Klosett und sieht seinen gelben Strahl und denkt dabei aber an den Bauch einer unbekannten Frau. Das war umwerfend, einfach umwerfend! Jedes Wort ruft komplizierte Assoziationen hervor. Ich glaube, das lyrische Ich ist geschockt, als es begreift, dass diese Flüssigkeit, die aus ihm hervorkommt, eine Ausgeburt von ihm selbst, also von seinem Körper, ist. Das ist eine eindeutige Anspielung auf die metaphysische Tragweite des schöpferischen Schreibens als Prozess, und vielleicht sogar auf die göttliche Schöpfung.” (Einem russischstämmigen Israeli hätte dieser Vergleich immerhin einleuchten können; писать – pisat’ – bedeutet nämlich sowohl „schreiben” als auch „pinkeln”.)
In diese Atmosphäre aus Postzionismus und Präwokismus – es wird bereits ein „Sichel-Preis für zivilgesellschaftliches Engagement” verliehen – gerät Itamar also mit seinem Drehbuch über Shaul Melamed, einen Kammersänger von Weltrang, der sich vor allem um das deutsche Kunstlied des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verdient gemacht hat, wobei kaum einer seiner Gesprächspartner auch nur einen Schimmer davon besitzt, was das ist. Es ist ja auch gleichgültig – und zwar buchstäblich. In einem TV-Kulturmagazin wird Melamed gezeigt, wie er das Lied aus Schuberts „Die schöne Müllerin” singt, in dem der Müllerbursche dem Bach seine Liebe gesteht, ich nehme an, es handelt sich um Nummer 6 („Der Neugierige”):
„O Bächlein meiner Liebe,
was bist du wunderlich!
Will’s ja nicht weiter sagen,
sag’, Bächlein, liebt sie mich?”
Sodann folgt ein Themenwechsel, und die Moderatorin wirbt für das „bahnbrechende” und soeben preisgekrönte „Rap-Musical Josh der G”:
„Josh, hey Josh, du Obermacker
Killer, Gangster, Motherfucker,
Bist der steilste Typ der Hood
Und machst einfach mal Jericho kaputt.
Inshallah! Bang-Bang, no shit:
Chabos strugglen, denn dein Spit
Lässt sie in die Hosen scheißen,
Während ihre Mauern reißen.”
Das alles ist unproblematisch; wo Josh der G sein Existenzrecht genießt, kann auch ein altmodischer Sänger irgendwelche verstaubten Liebeskamellen vortragen. Die Probleme beginnen damit, dass Melamed sich an zwei Stellen des Drehbuchs patriotisch – also pro-israelisch – äußert. Damit nimmt das Unheil seinen Lauf. In der Tel Aviver Filmbranche stößt Itamar ausschließlich auf den Typus des liberalen, sein Judentum und vor allem den Zionismus ablehnenden Israelis, der glaubt, dass Assimilation für Juden die beste aller Lösungen sei, sogar jene an die Araber, obwohl auch die bestens assimilierten deutschen Juden nichts vor der „Endlösung” geschützt hat. Melamed habe „Grenzen überschritten bei seinen Auftritten”, bekommt Itamar zu hören. Es sei da „so ein schneidender Ton in seinen Äußerungen” gewesen, „eine gewisse Kraftmeierei, wenn er von Israel gesprochen hat”. Der Sänger habe „die israelische Kriegsmaschinerie” in Schutz genommen und „Zwietracht gesät”. Im Drehbuch fänden sich Stellen, „die von einem Mangel an Empathie zeugen und die wir als Vertreter einer gemeinnützigen Organisation, die für staatliche Gelder verantwortlich ist, unter gar keinen Umständen ignorieren können”. Das Script müsse geändert werden.
Ein berühmter Regisseur soll den Film schließlich drehen, ein trendiger Berufsjugendlicher, der gemeinsam mit seinem hippen Assistenten (der auch sein Liebhaber ist) vom Drehbuch wenig übrigzulassen gedenkt. So soll beispielsweise der Flügel, auf dem Melamed begleitet wird, auf einer offenen Ladefläche durchs Land gefahren werden, vorbei an arabischen Dörfern, als Symbol der „Expansionsbestrebungen” der westlichen Kultur und „in dieser Umgebung genauso fremd wie die Häuser der jüdischen Siedler im Vergleich zu den natürlichen Bauten der Araber, die so wirken, als wären sie von selbst gesprossen aus dieser dunklen, warmen, fruchtbaren Erde”. Zu den Bildern eines von Kerosinlampen erhellten arabischen Dorfes mit seinen schlafenden Schafen und Maultieren soll aus dem Off die Stimme Melameds ertönen, in dessen Lied sich eine arabische Melodie mischt. „Der Gesang von Melamed wird immer leiser, und entsprechend lauter die arabische Melodie; am Ende wird nur noch sie zu hören sein.”
Da Itamar weder sein Manuskript ändern noch den bewunderten Freund verraten will, zieht auch er den Zorn der Wohlmeinenden auf sich. Wenn jemand erledigt werden soll, geht das nicht ohne die Presse. Eine so treffliche wie überzeitliche Passage des Romans lautet:
„Itamar hatte den Artikel nicht gelesen. Er hatte nicht die leiseste Vorstellung davon, was dieser Tage in der Redaktion der Zeitung auf der Tsidkiyahu-Straße in Tel Aviv und in der Holoner Wohnung der Journalistin Orit Mechmash vorbereitet worden war. Orit hatte sich in der Ecke der Redaktionskantine einen kleinen, intimen Arbeitsplatz eingerichtet. Dort standen ein Computer, ein Telefon und ein Faxgerät: mithin alles, was man für eine seriöse journalistische Recherche benötigte. Wie auch alle übrigen Ausgeburten der Hölle, derer die Zeitungen und Wochenzeitschriften zur Genüge haben, hatte auch diese Rakete Orit, aus den Kiosken und Läden abgeschossen, an jenem Morgen alle israelischen Wohnungen getroffen.
Minen dieser Art, große wie kleine, detonierten nahezu täglich. Hier liegt plötzlich ein Parteipolitiker mit einer Halswunde. Er liegt auf einer Trage im Krankenhaus und hofft, sich aufzurappeln und wieder auf die Beine zu kommen, doch nach einer weiteren Woche erhält er einen neuen, diesmal tödlichen Treffer. Da trifft einen Reserveoffizier ein Splitter in die Brust, als er davon liest, was er vor 30 Jahren getan haben soll. Hier zerfetzt es plötzlich einen Durchschnittsbürger, nachdem er sich damit einverstanden erklärt hat, an einer Fernsehdebatte über das Ethos der Armee teilzunehmen, und anschließend seinen Zank mit den Nachbarn in einem Zeitungsartikel vorfindet, worin, unter anderem, der Inhalt des Müllbeutels, den er im Treppenhaus verstreut haben soll, minutiös beschrieben wird. Dort haben wir einen Mathematikprofessor, der sich zur historischen Bedeutung dieses oder jenes Unglücks geäußert hat und dann, beim Öffnen seiner Lieblingszeitung, zu erfahren sich genötigt sieht, dass er zu Schulzeiten nur mit Mühe und Not die elementare Algebra bewältigt und von höherer Mathematik in seinem ganzen Leben niemals auch nur gehört habe.
So fährt also das mediale Flächenbombardement tagtäglich auf das Land herab, indem es Tote und Verletzte hinterlässt.”
Wobei der Ausgang dessen, was der Leser noch für den Beginn eines hollywoodesken Showdowns halten konnte, von einem so niederschmetternden Realismus ist, dass ich an dieser Stelle beschloss, meine notorische Priorisierung des Wie gegenüber dem Was einmal aufzugeben – es ist, wie gesagt, eine Kolportage, Satire, Groteske – und das Buch ins Schaufenster des Kleinen Eckladens zu legen.
Das lesenswerte Nachwort des Übersetzers Artur Abramovych erläutert die spezielle Situation der Kulturschaffenden in Israel zwischen Selbstverachtung und Selbstbehauptung, die der deutschen gar nicht so unähnlich ist. Es beginnt mit der lakonischen, kaum bestreitbaren Feststellung: „In der Geschichte der Moderne findet sich schwerlich ein links regiertes Land mit einem rechten Kulturbetrieb. Das Gegenteil ist hingegen nachgerade die Norm.” Damit ist der Kern des Übels benannt: Rechts oder konservativ regierte Länder tolerieren (oder fördern) einen linken Kulturbetrieb, der von ihnen zehrt und sie zugleich schwächt, während links regierte Länder die Rechten drangsalieren oder gleich verfolgen. Die tröstliche „Botschaft”, die der Roman zwar nicht direkt vermittelt, aber die Wirklichkeit an seiner Stelle, lautet: Zumindest in Israel ist dieses verlogene, parasitäre, intellektuell dürftige, denunziatorische, permanent Unfrieden stiftende Milieu inzwischen entmachtet und marginalisiert worden.
Wenn uns die Israelis vor einem Vierteljahrhundert voraus waren, warum nicht diesmal wieder?
(Wer das Buch beim Verlag bestellen mag, kann das hier tun.)